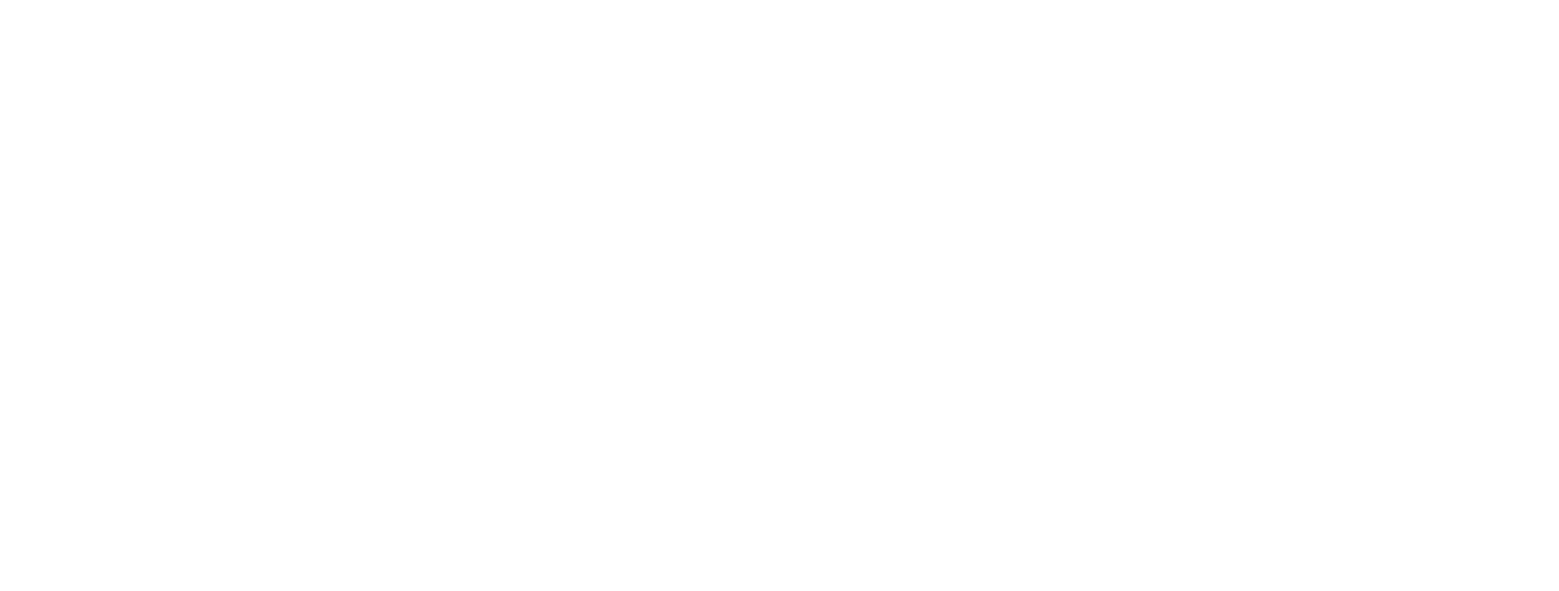Call for Papers als PDF
Evaluation und Wirkungsbetrachtungen sind Themen, die seit einiger Zeit die Gestaltung, Weiterentwicklung und Steuerung der Praxis des Lehrens und Lernens begleiten. Einerseits bildet Evaluation eine wichtige Säule der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements (Mitterauer, 2018; Pohlenz, 2018). Es werden Daten zur Qualität der Lehre, der Studiengänge und der Studienbedingungen sowie zum Prüfungs- und Studierverhalten der Studierenden bereitgestellt, die Eingang finden in Entscheidungsprozesse der Qualitätsentwicklung und Akkreditierung. Andererseits richtet sich durch projekthafte Formen der Förderung von Lehrinnovationen der Fokus auf die Wirkung(en) und Wirksamkeit von Maßnahmen sowie zugrundeliegende Wirkannahmen und Wirkmechanismen (Stiftung Innovation in der Hochschullehre, 2020, 2024). Evaluation kommt hier die Aufgabe zu, im Sinne einer Wirkungs- bzw. Begleitforschung Erkenntnisse darüber zu liefern, wie Projekte wirken und inwiefern sie ihre Ziele erreichen. Dabei stehen Evaluation, QM, Wirkungsanalysen und der Umgang mit Daten vor einigen grundlegenden Herausforderungen:
- Erstens bewegt sich die QM-Praxis im Spannungsfeld zwischen Rechenschaftslegung, evidenzbasierter Steuerung und lokaler Qualitätsentwicklung (Beise & Braun, 2018). In den Hintergrund geraten Ansätze, die sich stärker auf Feedback und Lernen sowie Forschen und Verstehen richten. Das gilt besonders für evaluationsorientierte QM-Ansätze, die mittels standardisierter Erhebungen eine Fülle an Daten erheben, aufbereiten, in Berichten dokumentieren, für evidenzbasierte Entscheidungen bereitstellen sowie das Ableiten von Maßnahmen über Follow-up-Prozesse einfordern.
- Zweitens überwiegen trotz methodisch ausdifferenzierter Evaluationssysteme in der Regel eher pragmatische Ansätze. Insbesondere die evaluationsorientierte QM-Praxis weist ein Potenzial zur wissenschaftlichen Fundierung und Systematisierung von Evaluation (Balzer & Beywl, 2018) auf.
- Drittens überwiegt ein instrumenteller Blick auf Evaluation und das Bereitstellen von Daten. Wie Akteure mit Daten umgehen, wie sie die Daten vor dem Hintergrund lokaler Spezifika und Informationsinteressen interpretieren oder welche (impliziten) Wirkannahmen, Wertvorstellungen und Denkmuster dabei eine Rolle spielen, bleibt weitgehend unhinterfragt (Ditzel, 2022).
- Viertens stehen angesichts der ungewissen Ausgestaltung einer ‚Hochschulbildung der Zukunft‘ (Wassmer et al., 2023) Ansätze unter Druck, die von einer planbaren Zukunft, von einheitlichen und verbindlichen Standards, von der Objektivität von Daten und von der Steuerbarkeit der Lehr- und Lernpraxis ausgehen. Gebraucht werden agile, kontextsensible Ansätze, die einen vorantastenden Handlungsmodus verbinden mit einer fortwährenden, strukturell abgesicherten, wissenschaftlich fundierten Reflexion der Effekte der Lehr- und Lernpraxis (Ditzel, 2023, S. 66).
- Fünftens geraten klassische, insbesondere quantitative Ansätze der Wirkungsanalyse mit Blick auf die Komplexität des Interaktionsgeschehens an ihre Grenzen (Altfeld et al., 2015). Auch lassen sich langfristige Wirkungen von Projekten in der Regel nicht innerhalb der Projektlaufzeit erfassen (Faaß et al., 2019, S. 5). Angesichts des Wunsches nach Wirkungsmessung bzw. Wirksamkeitsnachweisen gerät aus dem Blick, zu verstehen, wie Lehren und Lernen oder Innovationsprojekte wirken.
Mit Blick auf die skizzierten Herausforderungen stellt sich die Frage, wie Ansätze der Evaluation, Reflexion und Wirkungsorientierung sowie ihre organisationale Einbettung aussehen können. Ansätze für eine Akzentverschiebung der Evaluationspraxis finden sich beispielsweise im Hinblick auf flexible (Heinrich, 2020), qualitative (Brust et al., 2023; Frank & Kaduk, 2017; Mall, 2021; Steinhardt & Iden, 2012) und auf Reflexion ausgerichtete Ansätze der Evaluation sowie im Hinblick auf die Selbsterforschung der Lehr- und Lernpraxis im Sinne des Scholarship of Teaching and Learning (Fahr et al., 2022).
Mit dem Konzept einer ‚wissenschaftsgeleiteten Wirkungsreflexion‘ (Ditzel, 2023) haben wir im Projekt KOMWEID (Kompetenzen weiterentwickeln im digitalen Wandel) der HAW Hamburg einen konzeptionellen Rahmen entwickelt, wie eine solche Akzentverschiebung bezogen auf eine Reflexion der Lehr- und Lernpraxis einerseits und bezogen auf projekthafte Lehrinnovationen andererseits aussehen könnte. Im Kern geht es um einen wirkungsorientierten, forschend-fragenden, reflektierenden Blick auf die Handlungspraxis, bei dem Evaluation eine Grundlage für Reflexion und Lernen liefern. Dabei sind es nicht einzelne Aspekte wie eine wissenschaftliche Fundierung oder qualitative Evaluation allein, anhand derer sich die notwendige Akzentverschiebung beschreiben lässt. Vielmehr lässt sich ein veränderter Blick auf Evaluation – ausgehend von den Erfahrungen aus dem Projekt KOMWEID – entlang von unterschiedlichen Gestaltungsmomenten beschreiben (Ditzel, 2023, 2025): Wirkungsorientierung, Wissenschaftsorientierung, Integration von Reflexion in die lokale Handlungspraxis, Vielfalt der Betrachtungsobjekte und Evaluationsmethoden, Verknüpfung von Fremd- und Selbstreflexion sowie Ausweiten von Reflexion auf implizite Denk- und Handlungsstrukturen.
Ziel des geplanten Themenheftes ist es, geeignete Formate und Ansätze der wirkungsorientierten Evaluation und Reflexion auszuloten, die Herausforderungen eines solchen gegenüber klassischen Ansätzen der Evaluation und des QM veränderten Blicks zu diskutieren sowie theoretische und praktische Perspektiven der Evaluation/Reflexion/Wirkungsorientierung kritisch in den Blick zu nehmen.
Mögliche Beiträge
Im Themenheft möchten wir Lehrenden, Studierenden sowie Mitarbeitenden der Lehr-, Curriculums- und Qualitätsentwicklung einen Diskursraum zu Evaluation/Reflexion/Wirkungsorientierung bieten und sie einladen, Erfahrungen, Reflexionen, Konzeptionen, Zukunftsideen mit der Community zu teilen.
- Wie können Ansätze der Evaluation im Bereich Studium und Lehre – gerade auch mit Blick auf Projekte zur Förderung von Lehrinnovationen – aussehen, die einen wirkungsorientierten Blick auf die Lehr- und Lernpraxis richten, die eng auf die lokale Handlungspraxis bezogen bzw. in diese integriert werden, die sich wissenschaftlicher Zugänge bedienen, die Aspekte einer (wissenschaftlich fundierten) Selbstreflexion integrieren und/oder die implizite Sinnstrukturen wie Wirkannahmen bzw. Denk- und Handlungsweisen in den Blick nehmen? Welche Erfahrungen oder Konzepte zu derartigen Ansätzen der Evaluation bzw. Wirkungsreflexion liegen vor?
- Wie unterscheiden sich die Ansätze von klassischen Ansätzen der Evaluation, des QM, der Wirkungsforschung oder auch der angewandten Lehr-Lern-Forschung? Welche Potenziale ergeben sich für Hochschulpraxis, Hochschulforschung und/oder Hochschulpolitik? Welche konzeptionellen und/oder praktischen Herausforderungen gehen mit einem solchen Ansatz der wissenschaftsgeleiteten Evaluation/Reflexion/Wirkungsorientierung einher?
- Wie stellt sich ein derartiger Zugang aus unterschiedlichen Akteursperspektiven (Studierende, Lehrende, Hochschuldidaktik, QM, …) dar? Und konkret aus der Perspektive von Studierenden: Wann erleben Studierende Evaluation als hilfreich und zielführend? Wie könnte eine partizipative, entwicklungsorientierte Feedbackkultur aussehen?
Wirkungsorientierte Ansätze der Evaluation und Reflexion:
- Wie können Wirkung und Wirksamkeit von Maßnahmen stärker in den Blick genommen werden?
- Welchen Beitrag können qualitative Ansätze der Evaluation leisten, die Restriktionen klassischer Wirkungsmessung bzw. -nachweise im Kontext komplexer Interaktionsgeschehen zu überwinden?
Wissenschaftsgeleitete Ansätze der Evaluation:
- Welchen Beitrag kann Evaluation zu einem forschenden Blick auf das Lehren und Lernen im Sinne der Forschungslogik oder des Scholarship of Teaching and Learning leisten?
Ansätze der Integration von Reflexion in die lokale Handlungspraxis:
- Welchen Beitrag kann Evaluation zu Reflexion und Lernen im Sinne der Entwicklungslogik leisten? Wie können lokale Prozesse der Qualitätsentwicklung stärker unterstützt werden?
- Wie lassen sich die lokal Handelnden (Lehrende, Studierende) in das Planen, Entwickeln, Durchführen und Auswerten von Evaluationsansätzen einbeziehen? Welche Chancen, aber auch Herausforderungen gehen damit einher?
- Wie sehen Ansätze der wissenschaftsgeleiteten Reflexion aus, bei denen Lehrende selbst einen forschenden Blick auf Lehren und Lernen richten im Sinne des Scholarship of Teaching and Learning?
- Wie lässt sich bei der Gestaltung von Evaluationsansätzen mit sich widersprechenden Zielen und Logiken umgehen, insbesondere mit Blick auf eine Integration von Reflexion in die Handlungspraxis und eher klassische, managerielle Anliegen der Legitimation und Kontrolle?
Ansätze der Verknüpfung von Fremd- und Selbstreflexion:
- Welche Formen der Selbstreflexion haben sich in der Praxis bewährt oder bieten sich aus theoretischer Perspektive an?
- Wie kann eine Selbstreflexion wissenschaftlich fundiert werden? Welche methodischen und/oder theoretischen Bezüge lassen sich für eine Selbstreflexion nutzbar machen?
Ansätze zum Ausweiten von Reflexion auf implizite Denk- und Handlungsweisen:
- Wie können qualitativ-interpretative Ansätze der Evaluation bezogen auf die Lehr- und Lernpraxis, die Curriculumsentwicklung oder die Hochschulentwicklung aussehen? Wie können implizite Denkmuster und Grundannahmen sichtbar und damit einer Reflexion zugänglich gemacht werden?
- Wie kann die Perspektive der Handelnden z. B. durch qualitative Ansätze nicht nur stärker berücksichtigt, sondern zum Referenzpunkt der Bewertung werden? Welche Erfahrungen zu qualitativ-interpretativen Evaluationsansätzen liegen vor z. B. im Sinne einer dokumentarischen Evaluationsforschung (Bohnsack & Nentwig-Gesemann, 2020)?
Mögliche Betrachtungsobjekte und Evaluationsmethoden:
- Welche Ansätze haben sich bewährt, um nicht nur Lehre und Studium in klassischer Weise in den Blick zu nehmen, sondern Evaluation und Reflexion auch auf die Lernprozesse von Studierenden, lehr- und lernunterstützende Prozesse/Angebote, Prozesse und Strukturen der Hochschulsteuerung oder Lehrinnovationsprojekte zu beziehen?
Es sind explizit Beiträge willkommen, die weitere Facetten einer – angesichts gesellschaftlicher Transformationsprozesse und einer ‚Hochschulbildung der Zukunft‘ notwendig erscheinenden – Akzentverschiebung von Evaluation/Reflexion/Wirkungsorientierung vorstellen und diskutieren oder das Anliegen einer (wissenschaftsgeleiteten) Wirkungsreflexion kritisch beleuchten.
Die Einreichung von Beiträgen ist in folgenden Rubriken möglich: Forschungsperspektiven (als theoretischer oder empirischer Beitrag), Praxisperspektiven (reflektierte Praxisberichte), Zukunftsperspektiven (Skizzieren von Zukunftsideen), Umsetzungsperspektiven (praktische Handlungsempfehlungen und Leitfäden) sowie studentischen Perspektiven (siehe auch Rubriken).
Ausführlichere Informationen zur Einreichung von Beiträgen finden Sie unter https://www.haw-hamburg.de/qualitaet-in-der-lehre/komweid/horizont-lehre.
Zeitplan
- Februar 2025: Veröffentlichung des Call for Papers
- 31.12.2025: Deadline zur Einreichung vollständiger Beiträge
- Januar 2026: Rückmeldung/Review zu den Beiträgen
- Februar 2026: Überarbeitung der Beiträge
- März/April 2026: voraussichtlicher Erscheinungstermin des Themenhefts
Ansprechpartner
Benjamin Ditzel
Referent für Curriculumsentwicklung & Wirkungsreflexion,
Projekt KOMWEID, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
horizontlehre@haw-hamburg.de
https://www.haw-hamburg.de/qualitaet-in-der-lehre/komweid/horizont-lehre
Literatur
- Altfeld, S., Schmidt, U., & Schulze, K. (2015). Wirkungsannäherung im Kontext der Evaluation von komplexen Förderprogrammen im Hochschulbereich. Qualität in der Wissenschaft, 9(2), 56–63.
- Balzer, L., & Beywl, W. (2018). evaluiert: Erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich (2. Aufl.). hep verlag.
- Beise, A. S., & Braun, E. (2018). Systemakkreditierung zwischen Rechenschaftslegung, Steuerung und Qualitätsentwicklung: Befunde zu Zielen und Instrumenten der Hochschulen aus zwei qualitativen Studien. Qualität in der Wissenschaft, 12(2+3), 31–39.
- Bohnsack, R., & Nentwig-Gesemann, I. (Hrsg.). (2020). Dokumentarische Evaluationsforschung: Theoretische Grundlagen und Beispiele aus der Praxis. Verlag Barbara Budrich.
- Brust, L., Eisenberg, M., Kähler, K., Kanzinger, A., Klages, B., Schumann, M., Schwerin, K., & Timmann, A. (2023). Teaching Analysis Poll-Verfahren in Deutschland und transformatives Lernen: Eine Annäherung. Das Hochschulwesen, 71(5+6), 172–178.
- Ditzel, B. (2022). Paradigmen und Paradoxien des Qualitätsmanagements an Hochschulen. Ein theoretisch informierter Blick hinter die Kulissen formaler Implementierung. In P. Reinbacher (Hrsg.), Qualität und Qualitätsmanagement im Universitäts- und Hochschulbetrieb: Paradoxien, Probleme, Perspektiven (S. 57–108). Beltz Juventa.
- Ditzel, B. (2023). Wissenschaftsgeleitete Wirkungsreflexion – Ansätze der Qualitätsentwicklung für eine Hochschulbildung der Zukunft. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 18(3), 63–91. https://doi.org/10.21240/zfhe/18-03/04
- Ditzel, B. (2025). Gestaltungsmomente der Wirkungsreflexion. KOMWEID-Impulse, 1(16), 1–3. www.haw-hamburg.de/hochschule/qualitaet-in-der-lehre/komweid/impulse
- Faaß, M., Nguyen, T. T.-U., Ratzlaff, O., & Seemann, W. (2019). Projektevaluation an Hochschulen – Steuerungsinstrument oder Legitimationsfassade? Qualität in der Wissenschaft, 13(1), 3–8.
- Fahr, U., Kenner, A., Angenent, H., & Eßer-Lüghausen, A. (Hrsg.). (2022). Hochschullehre erforschen: Innovative Impulse für das Scholarship of Teaching and Learning (korrigierte Publikation). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34185-5
- Frank, A., & Kaduk, S. (2017). Lehrveranstaltungsevaluation als Ausgangspunkt für Reflexion und Veränderung. Teaching Analysis Poll (TAP) und Bielefelder Lernzielorientierte Evaluation (BiLOE). In S. Boomers, S. Hahn, & J. Ölbey (Hrsg.), QM-Systeme in Entwicklung: Change (or) Management? Tagungsband zur 15. Jahrestagung des Arbeitskreises Evaluation und Qualitätssicherung der Berliner und Brandenburger Hochschulen und Freie Universität Berlin, 2./3. März 2015 (S. 39–51). Freie Universität Berlin.
- Heinrich, M. (2020). Nachhaltigkeit durch Flexibilität, Reichweite und Diffusion: Das Marburger Modell einer Qualitätssicherung „on demand“. Qualität in der Wissenschaft, 14(1), 17–25.
- Mall, P. (2021). Qualitative formative Studiengangevaluation an Musikhochschulen: Kreative Optionen für kleinere (künstlerische) Studiengänge? Qualität in der Wissenschaft, 15(1), 10–13.
- Mitterauer, L. (2018). Entwicklung der Evaluation an Österreichs Universitäten. Qualität in der Wissenschaft, 12(1), 3–9.
- Pohlenz, P. (2018). Evaluation von Studium und Lehre an Hochschulen in Deutschland. Qualität in der Wissenschaft, 12(1), 10–14.
- Steinhardt, I., & Iden, K. (2012). Formative Studiengangevaluation: Erfolgreiche Verknüpfung der dokumentarischen Evaluationsforschung, des Expertengesprächs und universitärer Kennzahlen? Qualität in der Wissenschaft, 6(4), 105–110.
- Stiftung Innovation in der Hochschullehre. (2020). Hochschullehre durch Digitalisierung stärken: Präsenzlehre, Blended Learning und Online-Lehre innovativ weiterdenken, erproben und strukturell verankern [Förderausschreibung]. https://stiftung-hochschullehre.de/wp-content/uploads/2022/07/stiftunghochschullehre_fbm2020.pdf
- Stiftung Innovation in der Hochschullehre. (2024). Lehrarchitektur. Hochschule der Zukunft gestalten [Förderausschreibung]. https://stiftung-hochschullehre.de/wp-content/uploads/2024/01/StIL_Lehrarchitektur_Ausschreibungstext.pdf
- Wassmer, C., Probst, C., Sommer, K., & Wilhelm, E. (2023). Editorial: Hochschulbildung der Zukunft – Ein Resultat von Ausdifferenzierungsprozessen. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 18(3), 9–21. https://doi.org/10.21240/zfhe/18-03/01